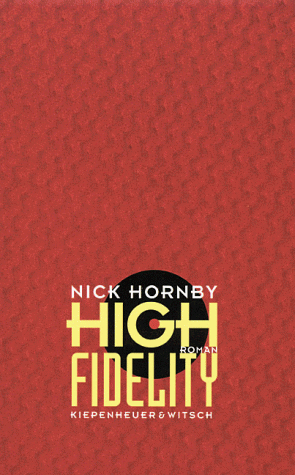Das ist meine Top 5 der „Romane, um die ich einen großen Bogen mache“:
- Romane, in denen Frauen Männer verlassen;
- Romane, in denen verlassene Männer ihren Frauen nachweinen;
- Romane, in denen es verlassenen Männern nicht gelingt, neue Frauen zu finden;
- Romane, in denen sich verlassene Männer an all die Frauen erinnern, die sie einmal verlassen haben, oder von denen sie verlassen worden sind;
- Romane, die damit enden, daß Frauen zu den Männern zurückkehren, die sie am Romananfang verlassen haben.
Müßte ich einen Roman nennen, auf den jeder der vorstehend genannten Punkte zutrifft, würde ich ohne zu zögern sagen: „Nick Hornby. High Fidelity. Ein Roman, der fünf gute Gründe enthält, ihn nicht zu lesen. Ich habe ihn gelesen – und würde es immer wieder tun.“ Dabei ist das Thema so alt wie die Literatur selbst: Du lebst in deiner kleinen Welt, und die wiederum steckt in einer anderen, größeren Welt, und das verträgt sich nicht. Das Universum von Rob Fleming, dem 35jährigen Ich-Erzähler, besteht aus Vinyl. Er hat einen Plattenladen in nicht unbedingt bester Londoner Geschäftslage, den er mit seinen ebenfalls diskomanischen Gehilfen Barry und Dick führt. Der Laden steht kurz vor der Pleite, Robs Beziehung zu Laura, einer Rechtsanwältin, hat diesen Punkt soeben erreicht. Sie verläßt die gemeinsame Wohnung, und Robs erste Tat besteht darin, eine Hitliste seiner fünf unvergeßlichsten Trennungen aufzustellen. Die von Laura gehört nicht dazu, aber das glaubt man ihm keine Sekunde.
Rasch wird deutlich, daß Robs Art zu denken wenig mit dem zu tun hat, was man von einem Mann im finsteren Mittelalter seines Daseins erwarten könnte. Er ist eigentlich nicht unglücklich darüber, wieder allein zu leben. Endlich darf er in seiner eigenen Wohnung rauchen und findet Muße, seine Schallplattensammlung neu zu ordnen. Während er sich dies logisch korrekt begründet, wächst seine Sehnsucht nach Laura, und als er sich endlich glücklich schätzen könnte, sie los zu sein – verzehrt er sich nach ihr, um sich nur wenig später in die Sängerin Marie zu verlieben, mit ihr zu schlafen – und sich noch mehr nach Laura zu verzehren. Natürlich könnte man ein solches Verhalten schlicht „verwirrt“ nennen, aber es geht um etwas anderes: In Rob vollzieht sich der Übergang vom Kind- zum Erwachsensein, er befindet sich also in jener spätpubertären Phase, wo man noch fleißig an seinen Idealen bastelt und dabei gleichzeitig schon dem Pragmatismus des Alltags brav zuarbeitet. Normalerweise geschieht dieser Übergang fließend, und ehe man es bemerkt, ist aus dem Jungen, der bei MC 5s „Kick Out The Jams“ von der Weltrevolution träumt, ein wackerer Funktionär der Jungen Union geworden, der vor autonomen Jugendzentren warnt. Bei Rob, der diese Phase mit gut zwanzig Jahren Verspätung durchleidet, vollzieht sich der Übergang allerdings traumatisch und wird bewußt empfunden.
Das alles ist sehr schön und lustig, ein wirklich lesbarer Roman mit dem legendären britischen Humor, der locker über den Tod-an-sich schwadroniert und selbst einer ins Gesicht geklatschten Torte philosophische Erkenntnisse abringen könnte. Doch während man liest, geschieht etwas, das jenseits aller literarischen Qualität angesiedelt ist. Der Leser erkennt sich selbst. Der Leser? Wir müssen das konkretisieren: Der übliche Leser von „High Fidelity“ ist zwischen 1945 und 1959 geboren. Für ihn war Popmusik stets mehr als nur tanzbarer Hintergrund erster Balzversuche. Sie war ein deutliches Signal an die marode Erwachsenenwelt, daß man mit ihr nichts mehr zu tun haben wollte. Man schloß sich mit Gleichgesinnten zusammen und provozierte die Intoleranz der Alten dadurch, daß man in einer Welt mit eigenen Wertvorstellungen lebte, einer Welt, in der aber kein Platz war für alles Andersartige, so daß sie selbst von dem lebte, was man den Alten vorwarf: der Intoleranz. Rocker verachteten Mods und umgekehrt, Fans der Rolling Stones wünschten Fans der Beatles ins Höllenfeuer. Von allen geächtet wurde der gemeine Schlagerliebhaber, dessen Intelligenzquotient niedriger sein mußte als die Anzahl der Umdrehungen pro Minute, welche eine Single von Roy Black auf dem Plattenspieler zurücklegte.
Man war ständig damit beschäftigt, die einzig wahre Musik auf Kassetten umzuschneiden und an Freunde zu verschenken – so, wie es Rob und seine Gehilfen auch tun. Keinen schöneren Beruf als den des Plattenkritikers konnte man sich vorstellen, und als Mitte der Siebziger Jahre der Zauber des Andersseins verflog, wurde man ein Teil jenes Phänomens, von dem die Friseurinnung noch heute ungläubig erzählt: Ganze Heerscharen junger Männer trennten sich von ihrer Haarpracht, weil die längst zur Mode geworden war und zum Protest nicht mehr taugte, seit einem unter jeder verfilzten Matte der zukünftige Bankkaufmann entgegenblinzelte.
Die typischen Leser von „High Fidelity“ sind keine Minderheit. Sie haben den Roman zu einem enormen Erfolg in Großbritannien werden lassen, sie haben die deutsche Startauflage von 50.000 Exemplaren binnen weniger Monate ausverkauft. Nun sitzen sie über der Lektüre und nicken pausenlos. Murmeln ihr „Ja, genauso war das!“ und erkennen, wer sie letztenendes aus dem Paradies der Hitparaden und Gitarrensoli vertrieben hat: die Frauen.
So kommt es natürlich, wie es kommen muß: Rob und Laura finden wieder zusammen, die wonnenreiche Dreifaltigkeit der Freunde Rob, Barry und Dick zerbricht, als sich letzterer in ein Mädchen verliebt, dessen Lieblingsband die Simple Minds sind. Plötzlich ist alles anders, und Rob entfährt der unerhörte Gedanke, man müsse die Menschen von nun an nach dem beurteilen, was sie sind, nicht nach dem, was sie mögen. Gemeinsam mit Laura besucht Rob ein Pärchen, dessen bloßes Ansichtigwerden er bis dahin wie der Teufel das Weihwasser gescheut hat, weil er nur zu genau wußte, was ihn erwarten würde: eine Plattensammlung aus Alben von Tina Turner, Simply Red, Mike Oldfield und Meat Loaf. Und die Katastrophe tritt tatsächlich ein: Rob findet das Pärchen trotz seines musikalischen Nullgeschmacks sympathisch, ja, er fällt sein eigenes Todesurteil, als er gelassen konstatiert, jeder solle nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist das Ende der Intoleranz, das Ende der Jugend.
An dieser Stelle nun endet auch das Nicken der Leserköpfe. Nein, man braucht nicht weiterzulesen, denn was jetzt kommt, Robs Normalwerdung gewissermaßen, ist ein dunkler Punkt der eigenen Biografie, als man selbst von einer Frau aus dem Paradies gelockt und dazu gezwungen wurde, glücklich, tolerant und erfolgreich zu sein. Der Leser wird diesen Roman, von dem er gewünscht hat, er ginge nie zu Ende, schließlich glücklich darüber, daß es ein Ende mit ihm hat, aus der Hand legen und hoffen, Hornby begehe nicht die Grausamkeit, ihm in einer Fortsetzung von „High Fidelity“ die kümmerlichen Überreste Robs vorzuführen.
„High Fidelity“ ist der endgültige Roman einer Generation domestizierter Rebellen, die schließlich wie Rob nicht einmal mehr in der Lage sind, ihre fünf Lieblingssongs aufzulisten. „High Fidelity“ ist also letztenendes eine Tragödie von antiken Ausmaßen, nur von denen wirklich nachzuvollziehen, die bei der Lektüre darüber grübeln, in welcher Besetzung die Band Canned Heat 1969 ihren Woodstock-Auftritt absolviert hat – und denen es partout nicht mehr einfällt.
Nick Hornby: "High Fidelity". Verlag Kiepenheuer & Witsch 1995 (39,80 DM)
Inzwischen auch als Taschenbuch: Nick Hornby: "High Fidelity". Droemer, Mchn.; (1999) 321 Seiten, 16,00DM