(Wochenanfang. Ihr seid erholt und könnt auch mal einen längeren, etwas komplexeren Text vertragen. Vier Din A 4 – Seiten, die doch nichts weiter sind als Gedankennotiz und vielleicht, vielleicht eines Tages Teil eines längeren, aus Aufsätzen zusammengewürften längeren Textes sein könnten. „Was ist Krimi“, ohne Fragezeichen, ein Gang durch die Historie des Genres in kleinen Schritten. Aber das ist Zukunftsmusik. )
Er habe, behauptete Leo Perutz, nie einen Kriminalroman geschrieben. Zutreffend; und doch könnte, wer nun unbezweifelbar Kriminalromane schreibt, bei Perutz lernen, wie man es macht. Spannende Unterhaltung auf sprachlich hohem Niveau und dennoch erfolgreich beim „breiten Publikum“, das Eintauchen in auf den ersten Blick verblüffend einfache, auf den zweiten verblüffend komplexe Geschichten, Wirklichkeitskonstrukte, durch die man als Leser wie ein Entdecker fremder Welten taumelt. Und noch mehr: Bei Perutz erfährt man überdies, was es denn auf sich hat mit der Wahrheit von Kriminalromanen und ihrer Binnenlogik. Richtig / falsch; gut /böse; aufgeklärt / nicht aufgeklärt. Das Perutz-Dilemma: Wie immer ich mich auch entscheide, es ist richtig und falsch zugleich.
„Der Meister des Jüngsten Tages“ von 1923 ist derjenige von Perutz’ Romanen, der die Behauptung des Autors, keine Kriminalromane geschrieben zu haben, am ehesten widerlegen könnte. Es ist die Geschichte des Freiherrn von Yosch, von ihm selbst erzählt, und genau das ist auch schon der entscheidende Punkt. Freiherr von Yosch reportiert die merkwürdigen Ereignisse, die eines Abends im Hause des berühmten Schauspielers Eugen Bischoff ihren Anfang nehmen. Jeder der Gäste weiß, dass Bischoff durch den Zusammenbruch eines Bankhauses bankrott ist – nur der Betroffene hat davon noch keine Ahnung, und die Gäste sind übereingekommen, ihr Wissen für sich zu behalten. Man musiziert, man erzählt, die Stimmung ist locker, ein Ingenieur namens Solgrub ist anwesend, der schrullige Arzt Gorski, Bischoffs Frau Dina (die auch einmal die Geliebte von Yoschs war) sowie ihr Bruder Felix.
Man erzählt sich Geschichten und irgendwann ist es an Bischoff, eine ganz und gar merkwürdige zum Besten zu geben, eine Geschichte, die von unerklärlichen Selbstmorden handelt, von Künstlern begangen, ohne wirkliches Motiv, ohne erkennbaren äußeren Anlass. Bischoff zieht sich für eine Weile in den Pavillon im Garten zurück, von Yosch verschwindet ebenfalls – und dann fällt ein Schuss, ein zweiter. Bischoff ist tot, von eigener Hand gerichtet.
Aber warum? Hat ihm jemand von seinem Bankrott erzählt? Ihm die Zeitung mit der Nachricht gezeigt? Natürlich, und man ist sich einig: Es war kein anderer als von Yosch, dafür sprechen alle Indizien.
Und jetzt beginnt das, was man als die große Kunst des Leo Perutz schon in seinen anderen Romanen schätzen gelernt hat. Das souveräne Spiel mit den möglichen Realitäten, ihre nicht aufzuhebende innige Verzahnung. Die Diagnose, Perutz verstehe es meisterhaft, Wirklichkeit und Phantasie zu mischen, greift zu kurz, denn man kann die Ebenen nicht voneinander trennen, nicht dieses als Wirklichkeit deklarieren, jenes als Phantasie abkanzeln. Von Yosch, auf dem ein schlimmer Verdacht lastet, erzählt seine Geschichte als Verteidigungsrede. Er hat Bischoff NICHT in den Tod getrieben, sein Selbstmord hängt vielmehr mit den merkwürdigen Fällen, von denen der Schauspieler ja selbst erzählt hat, zusammen.
Doch kann man von Yosch Glauben schenken? Man kann es nicht, denn der Ehrenmann, der er vorgibt zu sein, ist er kaum. Auch hat er ein handfestes Motiv, sich Bischoffs zu entledigen, macht ihm doch dies den Weg frei, Dina zurückzugewinnen.
Es sind kleine Äußerungen, die das belegen und die gleichzeitig von Yoschs Ausführungen diskreditieren. Er ist ein flatterhafter Charakter, ein Frauenheld, ein Lump gar, er spielt grausame kleine Spielchen, später werden wir etwa aus einer Beiläufigkeit erfahren, dass er eine seiner Geliebten in den Tod getrieben hat. Das wirklich Merkwürdige daran ist nun, dass sich von Yosch, indem er sich verteidigt, zugleich anklagt, denn natürlich stammen auch die belastenden Details aus seiner Feder.
Und das ist, wie gesagt, der zentrale Punkt, an dem der Leser vor einem unauflöslichen Dilemma steht. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man nimmt von Yoschs Geschichte für bare Münze oder man erkennt darin die vollkommene Verdrehung der Tatsachen zum Zwecke der Zurückweisung persönlicher Schuld. Wer nun aber von Yosch glaubt, darf sämtliche Hinweise auf seinen zweifelhaften Charakter NICHT glauben. Wer von Yosch für einen Schwindler hält, bescheinigt der „erlogenen Geschichte“ dagegen gerade in diesem Punkt Wahrhaftigkeit… Wie ich es also drehe und wende, ich bekomme die Wahrheit so oder so nur um den Preis der Unwahrheit.
Von Yosch entwickelt nun eine Handlung, wie sie einem Kriminalroman wohl ansteht. Solgrub und Gorski lässt die Sache mit den Selbstmorden keine Ruhe, sie beginnen mit Nachforschungen, auch von Yosch selbst wird investigativ tätig. Was sie herausfinden, deutet auf die Existenz eines dämonischen Wesens, jenes titelgebenden „Meister des Jüngsten Tages“, in dessen Macht es liegt, Menschen in den Tod zu treiben. Es ist Solgrub, der das Geheimnis schließlich lüftet und dafür mit seinem Leben bezahlt. Der Dämon ist kein Mensch, sondern ein Buch, ein Buch mit einer Geheimformel, der Geheimformel einer Droge, die dem, der sie eingenommen hat, das Unbegreifliche perfekter Kunst enthüllt, ihm eine noch nie gesehene Farbe – das von Perutz erfundene „Drommetenrot“ – vor Augen führt. Ein Erlebnis, das konsequent mit der Auslöschung der eigenen Existenz endet.
Es ließe sich nun einwenden, das Dilemma, in dem sich der Leser befindet, sei auf höchst einfache und logische Weise aufzulösen. Zwar setze sich von Yosch mit seiner Verteidigung in ein Licht völliger Unschuld, indem er eine Kriminalgeschichte erfindet. Eine innere Macht bringe jedoch Fragmente der Wahrheit an die Oberfläche des Erzählten, umbewusst für den Erzähler selbst. Mache ich mir diese Theorie zu eigen, bin ich aber nicht etwa ungeschoren aus dem Dilemma geflohen – sondern habe mich in ein erweitertes begeben. Denn dann wird die Geschichte glaubhaft, weil sie als Fiktion unglaubwürdig ist.
Zudem: Die Hinweise auf von Yoschs Schuld sind nichts weiter als Indizien, als Informationen, die ich als Leser interpretieren muss. Nichts ist eindeutig, obwohl vieles darauf hindeutet, dass es das ist. Keines dieser Indizien für sich alleine beweist irgend etwas, erst das Zusammenfügen sämtlicher Hinweise, ihre Zuordnung zu einem logischen Muster bringt mir Aufklärung. Der Leser wird also zum Ermittler außerhalb des Textes.
Dies allein wäre als Konstruktion schon bemerkenswert, doch Perutz setzt noch einen obendrauf. Das Buch, das wir in Händen halten, wurde uns von einem anonymen „Herausgeber“ zugänglich gemacht, dem das Manuskript des im Ersten Weltkrieg gefallenen von Yosch zufällig in die Hände gelegt wurde. Er ist es nun, der am Ende die Rolle des „guten Krimiautors“ übernimmt und die ach so verqueren Dinge geraderückt.
„Sollte es notwendig sein, es erst ausdrücklich zu sagen, daß Freiherr von Yosch den Hofschauspieler Bischoff, einen zu psychischen Depressionen neigenden und in diesem Zustand leicht beeinflußbaren Menschen, zum Selbstmord veranlaßt, daß er, von den Verwandten des Toten zu Rechenschaft gezogen und in die Enge getrieben, seine Zuflucht zu einem falschen Ehrenwort genommen hat?
Das ist der wahre Sachverhalt. Alles Weitere, das Eingreifen des Ingenieurs, die Jagd nach dem ‚Monstrum’, das geheimnisvolle Präparat, die Visionen – alles das ist abenteuerliche Erfindung. In Wahrheit hat die Affäre, über die der Kabinettskanzlei Sr. Majestät Bericht erstattet wurde, in einer ehrengerichtlichen Verurteilung des Freiherrn von Yosch ihren Abschluß gefunden.“
Mit diesen wenigen und lapidaren Sätzen wird scheinbar alles, was bisher behauptet wurde, obsolet. Der Herausgeber geht aber noch weiter und klärt uns über die Seelenlage von Yoschs, seinen zwanghaften Rechtfertigungsversuch auf.
„Erfahrene Kriminalisten (…) verweisen auf das ‚Spiel mit den Indizien’, auf jenen bei vielen Verurteilten beobachteten selbstquälerischen Drang, die Indizien ihrer Tat umzudeuten, sich selbst immer den Beweis zu erbringen, daß sie schuldlos sein könnten, wenn das Schicksal es nicht anders gewollt hätte.“
Klingt plausibel. Nun aber versteigt sich der Herausgeber in eine gewagte Analogie:
„Auflehnung gegen das Schicksal und nicht mehr zu Ändernde! Aber ist dies nicht – von einem höheren Standpunkt aus gesehen – seit jeher der Ursprung aller Kunst gewesen? (…) Mag die gedankenlose Menge vor einem Kunstwerk in Beifallsstürmen toben – mir enthüllt es die zerstörte Seele seines Schöpfers. In den großen Symphonien der Töne, der Farben und der Gedanken, in ihnen allen sehe ich einen Schimmer der wunderlichen Farbe Drommetenrot. Eine ferne Ahnung der großen Vision, die den Meister für eine kurze Weile über die Wirrnis seiner Schuld und Qual emporgetragen hat.“
Was ist passiert? Der Herausgeber hat von Yoschs Erzählung zur bloßen Phantasterei erklärt, mithin ihren Kern für das Produkt eines kranken, im „Spiel mit den Indizien“ umherirrenden Gehirns. Und im nächsten Satz bezieht er sich ausgerechnet auf diesen Kern – die Farbe Drommetenrot als Sinnbild der vollendeten und wahrhaftigen Kunst -, um seine Diagnose zu untermauern! Er befindet sich also in genau dem beschriebenen Dilemma: Er hält die Fiktion für unwahr und muss dazu den Kern dieser Fiktion als wahr ansehen.
Ein letztes noch: Die uns vom Freiherrn aufgetischte Kriminalgeschichte, ist, wenn wir sie aus ihrem Kontext lösen, geradezu paradigmatisch für das Wirken jener anfangs erwähnten „Binnenlogik“. Es beginnt mysteriös, beinahe überirdisch phantastisch, ein Dämon gar wird ins Spiel gebracht. Doch allmählich greifen die Rätsel ineinander und ergeben letztlich ein durchaus realistisches Gebilde. Eine Droge ist es, die an allem Schuld hat, Halluzinationen auslöst, das Gehirn derart schädigt, dass sein Besitzer in übergroßer Depression den Ausweg nur noch im Selbstmord sehen kann.
Mit den Anmerkungen des Herausgebers, die doch „Aufklärung“ bringen und die Verhältnisse zurechtrücken sollen, wird die herkömmliche Krimistruktur mutwillig zerstört. Für einen Anhänger des guten alten Krimihandwerks (das ja bis heute ebenso anachronistisch wie alltäglich ist) dürfte es nichts Schlimmeres als eben dieses Verdikt „Alles nicht wahr!“ geben.
Kriminalliteratur säubert die beschmutzte Wirklichkeit, Kriminalliteratur stellt Ordnungen wieder her, Kriminalliteratur nennt Ross und Reiter, sie findet Auswege aus jedem Dilemma, ja, sie wird nur geschrieben, um diese Auswege zu finden. Übliche Kriminalliteratur; bloße Selbstvergewisserungskost, von der man jedoch merkwürdigerweise erwartet, sie sei in der Fiktion „wahrhaftig“.
Spätestens jetzt ist „Der Meister des Jüngsten Tages“ zum Anti-Kriminalroman geworden, versetzt man ihn zurück in seinen Kontext, wird er quasi zu einem Metakrimi, zu einer sämtliche Theorien von Kriminalliteratur zugleich ad absurdum führenden wie konstituierenden Größe. Der allseits gehuldigten Konzeption einer in sich schlüssigen Textlogik (die sehr viel mit dem 19. Jahrhundert, seiner positivistischen Ausrichtung, seinem umfassenden „Machbarkeitsanspruch“ zu tun hat) stellt Perutz eine andere, so gar nicht bis ins Letzte zu fassende Welt-Anschauung gegenüber. Und das trifft es wohl am besten: Perutz zeigt uns die Welt, wie er sie sieht, der konventionelle Kriminalroman erklärt sie uns. Für ihn ist das Dilemma ein Rätsel, das gelöst werden kann und muss, für Perutz ist die Welt, ist Wirklichkeit selbst dieses Dilemma.
„Der Meister des Jüngsten Tages“ steht somit für ein literarisches Programm, das den Ernüchterungen, wie wir sie im 20. Jahrhundert beobachten können, das Zertrümmern von Ordnung und Ordnungsregulatoren gegenüber stellt. Auch in der Kriminalliteratur, auch hier abseits des „Mainstream“, auch hier mit der Konzentration auf dem „Beschreiben und Zeigen“.
Perutz zeigt uns, wie man schlechte und gute Kriminalromane schreiben kann, aber, nein, er hat tatsächlich nie einen Kriminalroman geschrieben.
Leo Perutz: Der Meister des jüngsten Tages.
Zsolnay 2006. 224 Seiten. 19,90 €
(Taschenbuchausgabe: dtv 2003. 9 €)
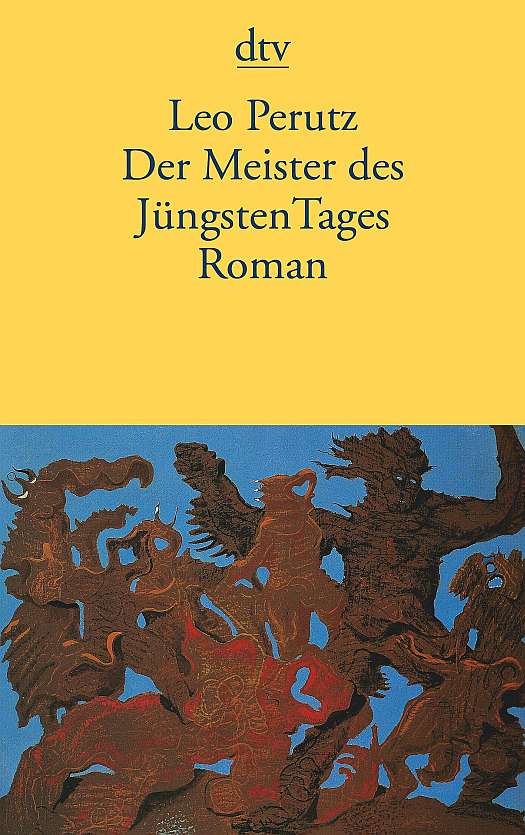
Selbst Agatha Christie liebte es, die Form bis zum Zerreissen zu strapazieren, wenn etwa der Erzähler der Täter ist. Bei Perutz ist sie zerrissen. Aber wenn der Täter ein Konstrukt entwirft nach dem Motto: so hätte es doch auch gewesen sein können, unterscheidet sich das nicht so sehr von, sagen wir, Bentleys „Trent’s Last Case“, wo der Ermittler vom Täter auf seine elaborierte Fehlkonstruktion des Tathergangs hingewiesen werden muss. Und Bentley steht ganz oben in der Rangliste.
Also, anstatt ihn aus dem Genre rauszuschmeissen, erheben wir den „Meister des jüngsten Tages“ zu einem seiner Meisterwerke. Allzu viele haben wir schließlich nicht und Schädels Bibliographie führt ihn auch an.
Grüße
luju
Uh, mein lieber luju, Sie stellen da schon am frühen Morgen die Gretchenfrage. Wie hältst dus mit den Genregrenzen? Warum Perutz letztlich doch Recht haben könnte mit seinem „Ich habe nie einen Kriminalroman geschrieben“, ergibt sich aus seiner Intention. Bei Christie und anderen dient das „Zerreißen“ der Form im Grunde den Genrevorgaben, deren gewichtigste sicher „Spannung“ und „Binnenlogik“ sind. Das Konstrukt ist also, ganz gleich ob ich es für überelaboriert, clever oder schlicht Unfug halte, der Lesererwartung verpflichtet. Perutz geht weit darüber hinaus, er müsste seinen Freiherrn gar keine KRIMINALgeschichte erfinden lassen, eine andere täte es auch. Natürlich bietet sich Krimi an, keine Frage. Die „Basistheorie“ bei Perutz, dieses nicht säuberlich zu trennende Nebeneinander unterschiedlicher Wirklichkeiten, bedarf des Krimis aber nicht unbedingt. Nehmen Sie etwa „Zwischen Neun und Neun“ oder „St. Petry Schnee“ (beide bei Schädel nicht aufgeführt; er nimmt nur den „Meister“ auf), zwei Stücke mit „Krimielementen“, mit Spannung, mit „Action“, aber von der Intention her weit vom Genre entfernt. Oder „Wohin rollst du, Äpfelchen?“, wo das Kriminelle nur anklingt, aber auch hier wieder dieses Zerrissene in Wirklichkeit, Chronologie und Logik.
Aber, nein, Sie haben schon Recht, wenn Sie den „Meister“ als eines der großen KRIMImeisterwerke schätzen. Ich tue es ja auch, aber eher mit Blick auf die ZUKUNFT des Genres: So könnte in hundert Jahren der NORMKRIMI aussehen, wenn sich der durchschnittliche Intelligenzquotient des gemeinen Krimilesers verdoppelt hat (ob er das tut, nun ja): spannend,hervorragend erzählt, im besten Sinne „trivial“, im besten Sinne „verstörend“. Interessant wird es natürlich dort, wo wir in der Kriminalliteratur nach Äquivalenten zum „Meister“ suchen. Also Werke, die keine billigen Binnenlogizismen anbieten, keine noch billigeren Dichotomien, keine allerbilligsten Welt- und Moralerklärmodelle. Hier könnte der Meister Ausgangspunkt und theoretische Stütze sein, von der aus man vor (Hammett und Konsorten, bis ins Heute mit Littell und Konsorten) und zurück schauen könnte. Ja, zurück auch. Holtei! In gewisser Weise auch Temme, dessen Sprache ich immer mehr bewundere, weil sie den Inhalt „zerreißt“. Bis ganz zurück zu Poe, der Everest, den man gerne zum Hügelchen runterdeutet, wenns um „Krimi“ geht. Etcetc. Sie merken schon: Was ist Krimi, das kann richtig spannend werden. Genregerecht eben.
bye
dpr