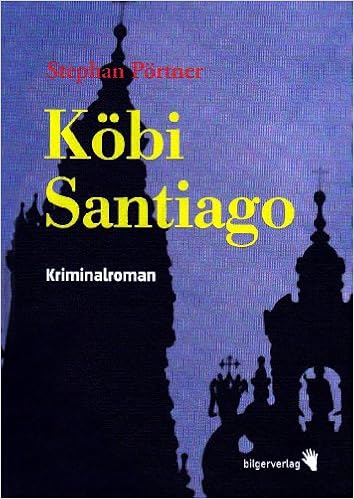Ja, der Köbi. Mit der Schweiz hat er abgeschlossen, in Spanien, in Santiago de Compostela, lebt es sich behaglicher. Geld steht ihm – woher eigentlich? – reichlich zur Verfügung und die Vergangenheit liegt weit hinter den sieben Bergen. Da passiert es. Köbi trifft einen Freund aus alten, stürmischeren Tagen in den Achtzigern, als „Züri brennt“ wörtlich zu nehmen war. Aber der Freund ist doch seit Jahren tot, oder? Ermordet…
Der Einstieg in Stephan Pörtners Roman ist klassisch. Ein Totgeglaubter lebt, er will seine Tochter in der Schweiz besuchen, die Tochter ahnt nichts von ihrem Glück, Köbi soll vermitteln. Dann ist der Wiederauferstandene zum zweiten Mal tot, diesmal endgültig, und Köbi, der in einem früheren Leben als Privatdetektiv gearbeitet hat, macht sich auf die Suche nach Täter und Tathintergründen.
Es wird eine Reise in die Vergangenheit, in die Zürcher Punker- und Anarchoszene, das kleine Drogenparadies und die anschließende Hölle des Scheiterns, des Aufstiegs, des Stillstands, der Normalität. Einen alten Bekannten nach dem anderen klappert Köbi bei seinen Recherchen ab, da ist er ganz akkurater Schweizer.
Auch das geschieht in klassischer Manier. Die einen sind zu Junkies herabgestiegen, die anderen haben sich von kleinen zu größeren Gaunern entwickelt, manche frönen der Gutbürgerlichkeit. Und auch die Staatsmacht mitsamt ihrer geheimen Apparate kommt ins Spiel. Wer inszenierte damals den „Tod“ des Freundes und warum? War er, der als eine Art Geschäftsmann in Sachen weiche Drogen agierte, ein Spitzel? Oder kam er den Global Swiss Players der Branche in die Quere?
Natürlich gerät Held Köbi irgendwann selbst ins Visier des Täters, ein weiterer Mord geschieht. Nachdem alle potentiell Verdächtigen abgehakt worden sind, steht der Bösewicht fest, es kommt zum Showdown. Klassisch eben wie das gesamte Konzept der Köbi-Romane, die in toto als Chronik Schweizer Haupt- und Gegenkultur funktionieren sollen.
Und gerade das ist zugleich Stärke und Schwäche des Romans. Was er, sprachlich solide, aber keineswegs überragend, über das Einst und Jetzt zu erzählen hat, ist ebenso vorhersehbar wie die Kriminalstory selbst. Nicht dass es falsch wäre, nicht dass es wirklich misslungen wäre. Aber dieses Inderspurlaufen der Geschichte hält auch den Leser auf Kurs, Genuss ohne Reue, Genuss ohne Nachwirkungen. Es kommt, wie es kommen muss, und manchmal eben etwas zu zahm, zu sehr der Absicht geschuldet, plakativ die Dinge auf den Punkt zu bringen. Unterhaltsam durchaus, wirklich aufregend jedoch nicht. Dass Schweizer zum Handy „Natel“ sagen und hinter den Bankfassaden der Abgrund lauert, dass die Idealisten von einst die Spießer von heute sind – schön, dass es noch einmal ausgesprochen wird. Ein netter Krimi also, der chronisches Kopfnicken verursacht.