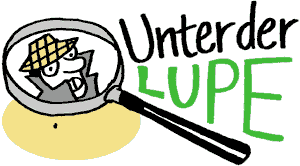
(Manchmal hilft ein genauer Blick, wo die große Rundumschau einer Rezension nicht weiterhilft. Eine Szene, ein Dialog, eine Kleinigkeit eben. In unregelmäßiger Folge seien bestimmten Kritiken Betrachtungen vorgeschaltet, die ein charakteristisches Merkmal des Textes unter die Lupe nehmen, erklären und seine Auswirkungen auf das Ganze prognostizieren. Heute widmen wir uns Uta-Maria Heims Krimi „Dreckskind“, die Besprechung gibt es voraussichtlich nächste Woche.)
Uta-Maria Heims neuer Roman „Dreckskind“ beginnt vielversprechend: Eine ältere Frau erinnert sich an ihre Kindheit, nach und nach enthüllt sich ihre tragische Geschichte, das Aufwachsen in einer kinderreichen Bauernfamilie, das Sterben der Geschwister und schließlich das traumatische Ereignis. Der kleine Bruder Emil wird von einem Zug erfasst und getötet, sie, die jetzt alte Frau, vom Vater für das Unglück verantwortlich gemacht und zum Krüppel geprügelt.
Sprachlich ist das in Ordnung; ein wenig zu symbolhaft aufgeladen vielleicht, aber das lässt sich verkraften. Ebenso der Sprung in die Gegenwart, als ein kleiner Junge, der wohl nicht zufällig auch Emil heißt, aus einem Festzelt verschwindet. Die Kapelle spielt gerade, was bei weinseligen Ereignissen im Württembergischen eher ungewöhnlich ist, eines der „Kindertotenlieder“ von Gustav Mahler, und der Leser mag sich an Reginald Hills „Das Dorf der verschwundenen Kinder“ erinnern, wo eben diesem Liederzyklus eine zentrale Bedeutung zukommt. In Ordnung. Das Ganze etwas gemächlich, aber das Ding hat schließlich 373 Seiten, die müssen gefüllt werden, und wenn die Autorin so weitermacht, ist es um die Lesezeit nicht schade. Nur: Es kommt anders.
Seite 37, Auftritt Kriminalhauptkommissar Timo Fehrle. Er soll den Mord an einem kleinen Mädchen aufklären, und das Verschwinden des kleinen Emil steht damit im Zusammenhang, ganz klar. Fehrle hat mit Frau und zwei Kindern gerade Urlaub in Italien gemacht, und wir erfahren nun, wie es so war am Gardasee:
„Nathan hatte schwimmen gelernt, und Fehrle hatte mit ihm Kieselsteintürme gebaut, die Jorinde wieder zerstörte. Sie waren mit dem Schlauchboot gepaddelt, Barbara hatte in der Sonne gelegen und gelesen, sie hatten gemeinsam mit den Kindern gekocht und gegessen, und Fehrle hatte die Abende allein mit Barbara verbracht. Wenn die Kinder schliefen, waren sie hinunter zum Strand gegangen und hatten Wein getrunken.“
Was man halt in Italien so macht im Urlaub, wenn die Kinder Nathan und Jorinde heißen. Doch der schönste Urlaub geht einmal zu Ende, und es heißt wieder: zurück in die Normalität.
„Am Vortag waren sie zurückgekehrt. Die Rückreise verlief zügig. Gegen halb neun kamen sie daheim an. Es war kühl draußen. Es dämmerte. Der Himmel war dunkelblau. Im Zwielicht war das Haus unheimlich. Der Neubau wirkte verlassen, obwohl im Flur Licht brannte. In der Küche lief das Radio. Fehrle machte es aus.“
Es dämmerte. Exakt. Es dämmert dem Leser, dass er gerade in eine Füllphase der Autorin geraten ist. Irgendwas muss geschrieben werden, irgendwas, das weder zur Geschichte gehört noch wirklich zur Personenzeichnung. Temporäres Chichi, gelesen, vergessen. Ein Radio läuft und wird ausgemacht. Eine Rolle Toilettenpapier könnte nicht exakt in der Halterung hängen und müsste neu justiert werden. So etwa. Aber jetzt setzt die Autorin noch eins drauf:
„Um halb neun hatten sie zusammen gefrühstückt, und Barbara war mit Nathan und Jorinde in die Kirche gegangen. Sie waren evangelisch, Fehrle war katholisch getauft. Als Kind war er bei den Ministranten gewesen; seine Eltern, die weit draußen auf dem Land lebten, gingen noch immer regelmäßig zur Messe.“
Über mehrere Seiten hat uns die Autorin nun mit Nichtinformationen gefüttert, Banalem, das für die Story belanglos ist und in der bestürzenden Tatsache gipfelt, dass Nathan und Jorinde – klingt übrigens wie der Titel eines zweiklassigen Singspiels aus dem 19. Jahrhundert – einer anderen Konfession als ihr Vater, der Exministrant, angehören.
Das mag man schulterzuckend abtun und rasch überlesen. Die Auswirkungen jedoch sind verheerend. Der Leser, der durch eine konzentrierte, anspielungsreiche und bedeutungsüberladene Eröffnung in das Buch gelockt wurde und sich seinem Erzähltempo angepasst hat, wird brutal ausgebremst. Seine durchaus vorhandene Neugierde weicht der Enttäuschung, seine geschärften Sinne lesen sich an Plattheiten stumpf. Das ist so, als werde man mit dem Versprechen „heißer Erotik“ in einen Nachtclub gelockt und dort von einer Hausfrau finstersten Mittelalters erwartet, die sich lustlos aus ihrem Hüfthalter quält.
Ganz augenscheinlich hat sich die Strategie der Autorin geändert. Sie erzählt nicht mehr die Geschichte eines Kriminalfalles, sondern versucht sich an der Zeichnung des ermittelnden Protagonisten, was ihr bei all den Nichtigkeiten, die sie uns über ihn zu erzählen weiß, grandios misslingt. Es ist die, nun nennen wir es: Mankellsche Krankheit, die hier wütet. Der Fokus liegt auf dem Helden, mehr aber auch nicht. Er wird aus reichlich Versatzstückartigem zusammengebastelt, die Handlung wird zum aside, zur mehr oder weniger beliebigen Schnur, an der man sich über 373 Seiten dem Ende zu hangeln kann.
Und es geht so weiter. Eine Kostprobe noch:
„In seinem Dienstwagen bretterte er auf der B 29 nach Bischofsweiler. Die 7000-Seelen-Gemeinde mit S-Bahn-Anschluss lag etwa dreißig Kilometer östlich von Stuttgart. Dort lebte die Familie seit einem Dreivierteljahr. Bischofsweiler lag im Elchenbachtal, mitten in einer pietistisch geprägten Weingegend, die sich auch zu einem Zentrum der Anthroposophen entwickelt hatte.“
Willkommen, bienvenue, welcome to Bischofsweiler! Idyllisch und mit S-Bahn-Anschluss in einer pietistischen Weingegend gelegen…und wir klappen den Werbeprospekt des örtlichen Fremdenverkehrsvereins resigniert zu. Das ist nun der Stil schlechter „Regionalkrimis“ und immer ein Indiz für entweder das Unvermögen oder die Unlust eines Autors, einer Autorin, ihre Arbeit auch im Detail zu feilen.
Ich weiß nicht, ob mir „Dreckskind“ als Krimi zusagen wird. Ich weiß aber, dass es mir schwerfallen wird, bis zum Ende durchzuhalten, mich durch all diese Belanglosigkeiten zu graben, um das Stückchen Story, das die Autorin verbuddelt hat, nicht aus den Augen zu verlieren. Bin mal gespannt.