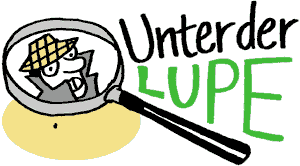
Zunächst sind Personen in Romanen nichts weiter als Namen, flüchtige Umrisse und Platzhalter für dramaturgische Entwicklungen. Je weiter wir bei der Lektüre vorankommen, desto lebendiger sollen die Personen und ihre Beziehungen untereinander werden. Eine große Aufgabe also für die AutorInnen. Leider wird sie speziell in Krimis nicht immer ernst genommen.
Aber gehen wir gleich in die Praxis, ein allüberall positiv aufgenommenes Werk der Schwedin Camilla Läckberg, „Der Prediger von Fjällbacka“. „Starke Charaktere mit viel Tiefgang“ heißt es zu diesem → „Krimicouch-Volltreffer Juni“. Ein Familiendrama von religiösen – ach was! – von biblischen Dimensionen. Schauen wir uns ein paar Seiten genauer an.
Gabriel und Laine Hult sind ein Ehepaar, bei dem es nicht zum Besten steht.
„Das hier war nicht das Leben, was sie sich erträumt hatte. (…) Es war die Sicherheit, die sie gelockt hatte. (…) Sie wollte ein Leben, das ganz anders war als das ihrer Mutter.“
Verständlich. Nur: Wen interessiert das? Es geht aber weiter.
„Als sie Gabriel gefunden hatte, glaubte sie wirklich, daß sie den Schlüssel gefunden hatte, der den dunklen Schrein in ihrer Brust öffnete.“
Abgesehen vom ungeschlachten, durch zwei grammatische Schnitzer kaum zu rettenden Stil: Was sagt uns das? Aber noch weiter.
„Nichts war schlimmer als Einsamkeit in der Zweisamkeit.“
Bei solchen Banalitäten kann man sich durchaus etwas Schlimmeres vorstellen: solche Banalitäten nämlich. Oder die allgegenwärtige Psychoanneliese:
„Die Schuld für Gabriels Verschlossenheit konnte zum großen Teil seinem Vater angelastet werden.“
Die aufgeführten Beispiele finden sich zwischen den Seiten 120 und 123 – und sind wirklich nur Beispiele. Für die genannten Seiten – für das gesamte Buch – für sämtliche dort vorgestellten Personen. Sie alle werden nicht erzählerisch entwickelt, sondern mit Gemeinplätzen etikettiert auf die Leserschaft losgelassen. Die darob natürlich keine Chance hat, sich das dramatische Szenario, in dem sich das alles ereignet, selbst zu erarbeiten, was aber doch – wenn ich nicht Jahrzehnte lang einem Irrtum aufgesessen bin – Sinn und Zweck von Literatur ist.
Auch der Kriminalliteratur? Da sind wir an einem heiklen Punkt. Man ist geneigt, die schriftstellerische Kompetenz von KrimiautorInnen in einem etwas milderen Licht zu betrachten, wenn nur das stimmt, was wir als Hauptaufgabe von Krimis ansehen: das Erzeugen von Spannung. Dagegen lässt sich wenig einwenden, genauso wenig gegen Leute, die vom Spargel nur die Spitzen essen und den Rest wegwerfen. Ist halt Verschwendung, aber was solls.
Ob nun „Der Prediger von Fjällbacka“ ein „spannender Thriller“ genannt werden kann, vermag ich nach etwas mehr als der Hälfte des Textes noch nicht zu sagen. Dass er hingegen voller Binsenweisheiten, plakativer Allerweltspsychologie und teilweise haarsträubend flachen Schlussfolgerungen steckt, das beweist er leider Seite für Seite.
Und Seiten gibt es, wie nicht anders zu erwarten, viele in diesem Buch, viel zu viele, über 400. Wenigstens 150 davon wären einzusparen gewesen, hätte sich die Autorin auf ihre Pflicht besonnen, uns das Personal nicht lang und breit zu erklären, sondern es selbst in knappen Sätzen und Gesten handeln zu lassen. Was zwischen Laina und Gabriel stattfindet, tuscht eine fähigere Autorin in wenigen beschreibenden Sätzen aufs Papier, in beiläufigen Beobachtungen und Dialogen, die nicht durch das geschwätzige Mahlwerk der krachenden Maschine „Erklären und Analysieren“ laufen. Und erspart sich damit zwerchfellstrapazierende Passagen wie die folgende von Seite 129:
„Patrik registrierte, daß sie (Laina) ‚mein’ Schlafzimmer sagte, und konnte nicht anders, als darüber nachzusinnen, wie traurig es doch war, daß verheiratete Leute nicht mal mehr zusammen schliefen. Das würde ihm und Erica nie passieren.“
Sehr traurig, da kann man nur zustimmen. Manche Leute haben getrennte Schlafzimmer, weil einer der Partner schnarcht, der andere im Bett noch lesen will, der andere nicht (jedenfalls nicht Läckberg) usw. Aber die Vorstellung, wie unser guter Ermittler plötzlich „nicht anders kann“ als „nachzusinnen“ – das ist schon komisch, und wie er sich dann vornimmt, es „besser zu machen“, das hat etwas Kindlich-Putziges.
Wie gesagt: kein Einzelfall. Weder in diesem Buch noch in jenem Teil der Kriminalliteratur, der durch sein unseliges Bestreben, besonders psychologisch geschliffen wirken zu wollen, in Seichtheit abdriftet. Und der Leser, die Leserin? Ist es ihnen gleichgültig, wenn nur „der Plot“ Spannung verspricht? Lassen Sie sich alles vorkauen wie zahnlose Greise des Geistes, die sich nicht wehren können oder wollen, wenn man sie mit altbackenem, in Brackwasser eingeweichtem Brot füttert? Schade wäre das schon.
wobei die (grammatischen) fehler und wierholungen und stilistischen stolpersteine natürlich auch an der übersetzung liegen können. die klischees aber natürlich nicht, da hilfts ja nix, wenn du ein unverbrauchteres verb benutzt. ich krieg schon die krise, wenn ich sowas am nebentisch höre.
*holt ihr auto aus dem parkverbot
**heute zu ikea
Das DU dich zum Konjunktiv äußerst, freut mich, meine Liebe. Und hast natürlich recht: Übersetzungsgeschludere. Gegen Einsamkeit in der Zweisamkeit kommt aber kein Übersetzer an. Das ist einfach zuunterst. Gottseidank ist man in Wiesbadener Krimiautorinnenkreisen vor solchen Sachen gefeit.
bye
dpr
*IKEA? Neues BILLY-Regal?
nee, einen bilderrahmen.und ein frühstück.
ach, übrigens habe ich eine nuss für dich zu knacken, pass auf … eine geschichte wird erzählt (erzählzeit präteritum), und zwar immer mit einem vorgriff auf die vergangenheit, was ich sehr schön finde.
also z.B (du musst dir einen ruhigen duktus vorstellen): „später würde er immer an diese mittagessen zurückdenken, die er mit ihr beim fischladen eingenommen hatte.“
jetzt könnte ich natürlich auch schreiben:
„später wird er immer an diese mittagesssen zurückdenken, die er mit ihr beim fischladen eingenommen hatte.“
das „würde“ (hier kein konjunktiv) (deutsche sprache schöne sprache!) empfinde ich in diesem fall (in meinen ohren jedenfalls; es geht ein paar mal in der geschichte so) als die poetischere lösung als das wird (taucht so vier/fünf mal in der geschichte auf).
aber jetzt warum? was ist der unterschied?
*im sprachwissenschaftlichen seminar mit dpr; zeigt ihren beispielsatz
Würde oder wird. Das würde ist zunächst einmal ein Reflex der handelnden Person. Ich sitze beim Essen und weiß, dass ich daran zurückdenken werde. Das wird ist eine Information von außen, von der Erzählebene. Es wird so sein. Beim würde nimmt sich die Person vor, daran zurückzudenken.
Mit poetisch hat das, meiner Meinung nach, wenig zu tun. Es ist eine Erzählstrategie. Mit einigen Fallstricken, hier: Hilfsverben. Diese Präteritumgeschichten sind, wie übrigens auch die indirekte Rede, abhängig von den Hilfsverben, die zahlen- und formmäßig beschränkt sind. Tritt das geballt auf, wirds einfach hölzern. Warum nicht vom Präsens aus erzählen?
„Später denkt er an diese Mittagessen zurück (das „immer“ ist äußerst unelegant), die er mit ihr beim Fischladen eingenommen hat (nicht hatte! Das ist eine zu breite zeitliche Kluft!). Das verlagert die Erzählebene und macht sie greifbarer. Ist vor allem auch stilistisch flexibler.
So, jetzt sind aber Semesterferien.
bye
dpr
neeeeeee, die konstruktion mit dem würde ist viel schöner, aber es darf natürlich nicht wie eine anreihung sich wiederholender hilfsverben klingen …
*widerspricht
„Schöner“ ist, denke ich, kein literarisches Kriterium…Es soll deiner Intention entsprechen. Wo liegt der Fokus? Auf der Person oder dem Autor? Unmittelbar (dann wäre das „würde“ passender“) oder leicht auf Distanz (kommt nur „wird“ infrage). Die Präsenskonstruktion wäre ein Mittelweg.
bye
dpr
*Widerspruch? Hab ich das eben richtig gelesen? Widerspruch?
**kramt ein Kapitel „Winzerkrimi“ plus Rotstift hervor
gut, dann schreibe ich den nächsten krimi im präsens!
ich essen immer im fischladen mit ihr.
*mör-der-satz
**widerspricht!
Später dächte er zurück? Jetzt schreiben wir für die Generation Goethe! Präsens, werteste Anobella, hat ja auch Nachteile, wie du weißt. Das Unmittelbare. Ich kann gelecktes Präsens nicht lesen, ausformuliertes JETZT, das ist unnatürlich. Da ist die Vergangenheit besser. Oder mischen! So mach ich das. Alles was außerhalb des Protagonistenkopfes stattfindet: Vergangenheit und dritte Person Singular und hübsch ausformuliert. Alles kopfinterne: Gegenwart, ICH und auch mal sprunghaft-fragmentarisch.
bye
dpr
*widerspricht auch
*widerspricht noch mehr
DÄCHTE natürlich nicht. das poetische ist das hilfsverb würde in diesem fall, das zu werden gehört, aber hier nicht der konjunktiv ist.
**breitet ihre verbtabelle auf dpr`s tisch aus
***zeichnet „würde“ als vorausgreifende, abgeschlossene vergangenheit an
Später dächte er dann an den Widerspruch, den er in ihren Kommentaren zu lesen geglaubte hatte.
Nämlich, hochwerteste Anobella, es ist so: Dächte. Heißt: Tja, könnte sein, dass er dran denkt. Hält es doch poetisch erst in der Schwebe (sofort notieren! „Poetisch in der Schwebe halten“. Ins Krimiporträt einbauen: A.P. hält den Text poetisch in der Schwebe. Jau!).
Aber wenn du natürlich keine Poesie willst…
bye
dpr
*hat früher sogar Gedichte gelesen
**solche: Das Nashorn hat ein Nashorn / Die Rose einen Rosdorn.