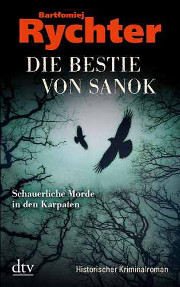 Schauerroman? Gerne. Vorkarpaten? Warum nicht. Da lauert hinter jeder Wegbiegung mindestens ein Vampir oder sonst etwas Untot-Unheimliches. Die Wälder sind düster, die Straßen von Sanok, jenem polnisch-ukrainischem Provinzkaff unter österreichischer Herrschaft, ebenso. Man schreibt das Jahr 1896. Das Setting von Bartlomiej Rychters Roman ist wie geschaffen für jenes wohlige Gruseln, dessen sich die Kriminalliteratur gerne bedient, wenn sie uns verwirren möchte. Übernatürlich? Ja, anfangs. Aber irgendwann muss alles logisch in unsere nüchternen Köpfe, da hat es sich ausgegruselt, da wollen wir Fakten und Motive, da sind wir ganz aufgeklärt und technokratisch. Die Herausforderung für Autoren solcher Romane liegt also immer darin, die Kurve zu kriegen, vom dramatisch-verwuselt Emotionalen zum Rationalen zu gelangen. Wie gelingt es hier? Etwas gezwungen.
Schauerroman? Gerne. Vorkarpaten? Warum nicht. Da lauert hinter jeder Wegbiegung mindestens ein Vampir oder sonst etwas Untot-Unheimliches. Die Wälder sind düster, die Straßen von Sanok, jenem polnisch-ukrainischem Provinzkaff unter österreichischer Herrschaft, ebenso. Man schreibt das Jahr 1896. Das Setting von Bartlomiej Rychters Roman ist wie geschaffen für jenes wohlige Gruseln, dessen sich die Kriminalliteratur gerne bedient, wenn sie uns verwirren möchte. Übernatürlich? Ja, anfangs. Aber irgendwann muss alles logisch in unsere nüchternen Köpfe, da hat es sich ausgegruselt, da wollen wir Fakten und Motive, da sind wir ganz aufgeklärt und technokratisch. Die Herausforderung für Autoren solcher Romane liegt also immer darin, die Kurve zu kriegen, vom dramatisch-verwuselt Emotionalen zum Rationalen zu gelangen. Wie gelingt es hier? Etwas gezwungen.
In Sanok also geht eine Bestie um. Sie fällt über Ratsherren her, zerfleischt sie, ob in den dunklen Gassen oder den gewiss kaum helleren Wohnzimmern. Ein Werwolf, munkelt der Volksaberglaube. Die Staatsmacht in Gestalt eines zynisch-korrupten österreichischen Polizeibeamten ist machtlos, die Geschichte schreitet langsam voran, entfaltet sich, stellt ihr Personal vor. Eine jüdische Prostituierte und ihren geheimnisvollen weiblichen Gast auf dem Dachboden, eine „Witwe“ am Rande des Ortes, von allen gemieden, weil sich ihr Mann aus dem Staub gemacht hat. Einen panischen Apotheker, einen dubiosen Journalisten, einen Arzt und seinen Gast aus Wien, einen Professor, vor allem aber Borys, den jungen Hauslehrer der kranken Tochter des Arztes. Er hat das zweite Gesicht, er sieht das Unheil im Voraus. Gemeinsam mit dem Professor wird er quasi als Ermittlungsteam fungieren. Derweil die Bestie munter mordet.
So weit so annehmbar. Das was man „Ambiente“ nennen könnte, hat Rychter souverän im Griff, dieses Fin-de-Siècle-hafte in einer kleinen Stadt, die Beklommenheit, die Spannungen, das Gefühl, dass es unter der Oberfläche brodelt. Aber irgendwann muss er eben die Kurve kriegen, denn wer gibt sich schon mit einem Werwolf als Täter zufrieden? Es kommt zu den üblichen dramaturgischen Höhepunkten, gothicnovellike eben, man kann sie sich vorstellen, ohne den Roman gelesen zu haben. Da keucht die Bestie und ihr Atem stinkt, eine Liebesgeschichte wird eingewoben, Frauen geraten in Gefahr, manche Personen sind nicht die, die zu sein sie vorgeben. Und dann der große Umschwung. Neue Figuren tauchen auf und werden wichtig, die Zeit drängt, der Fall muss aufgeklärt werden, es müssen Tatsachen her.
Tja, und hier wird es schwierig für den Leser. Konnte er der langsam erzählten Geschichte bislang durchaus etwas abgewinnen, wird er nun mit den rationalen Hintergründen der Ereignisse konfrontiert und weiß kaum noch, wo ihm der Kopf steht. Rychter hat einen Whodunit geschrieben und ein Whodunit funktioniert nun einmal so. Gegen Ende muss alles erklärt werden, hektisch und wenig überzeugend. Nichts gegen die Referenz an „Den Hund der Baskervilles“, aber besonders souverän wirkt das alles nicht. Ist schade. Nicht immer ist dann, wenn sich alles fügt, auch alles in Ordnung. Und es ist wesentlich leichter, Mysterien zu erschaffen als sie wieder zu beseitigen. Rychter ist es nur notdürftig gelungen.
Bartlomiej Rychter: Die Bestie von Sanok.
Dtv 2012 (Zloty Wilk. 2009. Deutsch von Lisa Palmes). 366 Seiten. 9,95 €