Dass es hier Probleme mit den Kommentaren gibt, ich nach wie vor mit Spam zugemüllt werde – es dürfte euch nicht entgangen sein. Und jetzt komm ich dahinter, dass RICHTIGE Kommentare ganz rigoros gar nicht erst diesen Blog zu erreichen scheinen. Oder irgendwohin verschwinden, wo ich sie niemals vermuten würde. Dachte schon, ihr mögt mich nicht mehr… Würdet ihr mal ein paar Kommentare schreiben und mitteilen, wie toll oder beknackt wtd ist oder ob es bei euch gerade regnet, stürmt und schneit? Ich versuche dann mal, die unerforschlichen Wege der Kommentare zu verfolgen. Es ist ein Jammer…
Kategorie: Watching the detectives
Matthias Wittekindt: Schneeschwestern
 Reden wir über Kitsch. Was ist das? Kitsch ist die Nachahmung des Originellen, das Errichten potemkinscher Fassaden vielzimmriger Worthäuser, aber eben nur die Fassaden, ein Täuschungsmanöver für flüchtige Augen. Im Kitsch offenbart sich falsches, weil oberflächliches Lesen. Alles etwa, was heutzutage „romantisch“ daherkommt, hat Romantik nie wirklich verstanden, ahmt den Ton nach, trifft ihn aber nicht. Kitsch will mehr sein, Kitsch will Kunst sein, unbedingt, Kitsch strebt nach dem Höheren und löst sich doch nie von seinem traurigen Ausgangspunkt: dem Unvermögen zur originellen schöpferischen Leistung.
Reden wir über Kitsch. Was ist das? Kitsch ist die Nachahmung des Originellen, das Errichten potemkinscher Fassaden vielzimmriger Worthäuser, aber eben nur die Fassaden, ein Täuschungsmanöver für flüchtige Augen. Im Kitsch offenbart sich falsches, weil oberflächliches Lesen. Alles etwa, was heutzutage „romantisch“ daherkommt, hat Romantik nie wirklich verstanden, ahmt den Ton nach, trifft ihn aber nicht. Kitsch will mehr sein, Kitsch will Kunst sein, unbedingt, Kitsch strebt nach dem Höheren und löst sich doch nie von seinem traurigen Ausgangspunkt: dem Unvermögen zur originellen schöpferischen Leistung.
Kitsch zu erkennen, ist nicht immer leicht, denn entgegen der landläufigen Meinung steckt er nicht nur in „Lore“-Romanen und schwülstigen TV-Arztserien. Er verbirgt sich in Worthülsen, ist Modeschmuck, Talmi, er schwingt sich zu Gedanken auf, die einen in Ehrfurcht erstarren lassen, große Gedanken über die Menschen und die Welt und die Moral und überhaupt. Das beeindruckt, wenn man es beim ersten Blick und der wie mit Kanonen verschossenen Botschaft belässt. Und die Claqueure tun, was Claqueure nun mal tun: sie applaudieren. Bis irgendwann die Klatschhändchen erlahmen, weil die Zeit (nein, nicht die Wochenzeitung, die nicht) einen bösen Verdacht mit sich gebracht hat: Das ist alles Kitsch. Das ist das gute daran: Irgendwann entlarvt sich Kitsch von selbst, mal früher, mal später.
Wir hegen also die begründete Hoffnung, dass es auch einmal MatthiasWittekindts „Schneeschwestern“ erwischen wird. Der Inhalt des Buches kann lapidar in wenigen Sätzen zusammengefasst werden: Ein Mädchen wird ermordet. Und hätte die Polizei von Anfang an ihre Arbeit vernünftig getan, wäre der Fall nach 80 Seiten gelöst gewesen. Hätte sie zum Beispiel nach der Tatwaffe gesucht anstatt Polizistinnen „den Mond anschreien“, sie durch den Schnee stolpern und viele tiefgründelnde Flachheiten vom Stapel hauen zu lassen. Aber auch die potentiellen Täter sind nicht besser. Was sind sie eigentlich? Weiß man nicht so genau. Irgendwie Getriebene, die sich nicht im Griff haben oder ständig beim Pfarrer Dinge beichten wollen, die sie nicht getan haben. Und die Opfer? Jugendliche halt. Als potentiell dreidimensionale Wesen in der Handlung abgeladen und dort von der Sprachwalze des Autors kundig platitüdiert. Das Ganze spielt übrigens in Lothringen, unweit der deutschen Grenze, auch in Saarbrücken wird mal ermittelt.
Aber am schlimmsten sind die Polizisten. Der eine hat ein Problem mit seiner Freundin, der andere damit, keine zu haben. Eine Polizistin (die den Mond angeschrieen hat) findet zwar einen Freund, aber es ist irgendwie nicht der richtige. Ginge ja alles in Ordnung, würden die Leutchen nur ihren Job richtig machen und sich nicht ständig daran erinnern, dass sie sich gerade an etwas nicht erinnern, das aber natürlich höchst wichtig ist…
Nein, Korrektur: Am schlimmsten sind doch nicht die Polizisten, am schlimmsten ist die Sprache, denn die ist Kitsch pur. Wir erinnern uns: Kitsch ist die Nachahmung des Originellen etc. Also eine Sentenz wie diese etwa:
„Die Straße. Weiß. Sein BMW. Schwarz. Noch immer eine kleine Freude, der Anblick. Roland Colbert steigt ein, startet den Motor, schaltet das Licht ein. Blau. Die Tachobeleuchtung ist blau. Roland Colbert achtet nicht darauf. Es geht jetzt um Wichtigeres.“
Um Missverständnisse zu vermeiden: Nicht die Sprache an sich ist hier kitschig und der Rezensent ist auch nicht der letzte Ritter dudenkonformer vollständiger Sätze. Sprache ist überhaupt selten kitschig, viel mehr sind es die Absichten dahinter. Und die Absicht hinter diesen Sätzen lautet: Literatur. Weder dienen hier die Ein-/Zweiwortsätze dazu, einen bestimmten physischen (Eile) oder psychologischen ( sich vergewissern) Zustand zu unterstreichen. Noch wird hier ein Erzählduktus konsequent durchgehalten. Nein, es ist viel simpler: Jemand setzt sich in sein Auto und fährt weg. Es einfach hinschreiben? ZU einfach. Denn Wittekindt möchte Literatur herstellen, leider hat er vergessen, dass die nicht nur darin besteht, ein paar halbtiefe Gedanken (gerne auch mit Schopenhauer-Erwähnung) in einer Untiefe aus sprachlicher Pseudoartistik zu baden, um sie schön manieriert zum Trocknen aufzuhängen. Stimmt ja. „Die Straße. Weiß. Sein BMW. Schwarz“: Das klingt nicht nach Schulaufsatzdeutsch, das klingt nach „mehr“.
Dieses „Mehr“ treibt gelegentlich in aberwitzige Sphären, so wie der Wind den Schnee auf einer Wehe. „Es schneit keine dicken Flocken, sondern mitteldicke. Und sie fallen natürlich auch nicht von oben, sie bewegen sich schräg.“ Aha. Was schräg runterfällt, fällt nicht von oben? Good to know.
Nun denn. Kitsch ist, wenn die Sprache ein eitles Eigenleben führt, eine Königin ohne Land, ohne Bezug zum Inhalt. Was bleibt übrig? Ein reichlich überflüssiger und wirrer Krimi, der 350 Seiten benötigt, um nichts zu erzählen.
dpr
Matthias Wittekindt: Schneeschwestern.
Nautilus 2011. 349 Seiten. 18 €
Fünf Wünsche für 2012
Fast geschafft. Allen Leserinnen und Lesern die obligatorischen guten Wünsche zu Fest und Jahreswechsel – ja, und was wünschen wir uns krimimäßig für 2012? In aller Bescheidenheit:
- Weniger Schablonen (Eintreffwahrscheinlichkeit: 2%)
- Mehr Risiko (3%)
- Weniger kritische Konfektion (4%)
- Mehr Toleranz (0%)
- und ganz allgemein eine geringere Arschlochdichte (keine Prognose)
In diesem Sinne: Bis 2012! (wo es auch →den wieder geben wird…)
Historisierend und historisch: zwei Krimis
Historische Krimis sind Mogelpackungen. Jeder Krimi ist historisch, hinterlässt er doch den Nachgeborenen etwas über die Verhältnisse, die Denkweisen seiner Entstehungszeit. Was allgemein als historisch etikettiert wird, ist hingegen historisierend, ein Nachbau von Vergangenem, der weder seine Abhängigkeit von der Zeit seiner Entstehung noch seine zwangsläufige didaktische Absicht leugnen kann. Uns Lesern soll etwas vermittelt werden, wir sollen etwas lernen, bestenfalls bietet man uns Infotainment, schlechtestenfalls das Dröge einer faktenvollen und blutleeren Geschichtsstunde im zeitlos morschen Gerüst eines 08/15-Krimis.
Weiterlesendpr ohne Stimme
Hm, das ist Fernsehen. Sagen darf man nix und eine Freundin bekommt man auch noch angedichtet. Lässt sich →hier angucken (Beitrag „Autor ohne Stimme“ auswählen, dazu mit der Maus über den blauen Balken rechts…).
Was ist Krimi? Neues aus der Zettelwirtschaft 12
Und weiter gehts beim lustigen Fragenbeantworten. Diesmal von NOIR bis MAGGI, von Glauser bis Manierismus. Ein Ende? Nicht abzusehen.
WeiterlesenDas Jahr was war
2011? Abhaken. 2012? Abwarten. Für alle Nostalgiker gibt es ab sofort einen kleinen, deutschzentrierten Rückblick auf die verflossenen zwölf Monate. Natürlich auf der →Krimicouch.
Die Scharmützel der Phantome
Es herrscht Krieg. Kein heißer, kein kalter, eher ein lauwarmer, wie es dem Gegenstand angemessen ist. Es geht um etwas höchst Belangloses, um Kriminalliteratur, die nur für wenige mehr ist als das feierabendliche Quantum Entspannung und Ablenkung, Abzittern und Ablachen. In gewisser Weise also das, was man einen akademischen Krieg nennen könnte, wäre nicht „Krieg“, wenn ich es mir so recht überlege, die unpassende Bezeichnung. Nennen wir es also Scharmützel. Ein ulkiges Wort für eine im Grunde ulkige Geschichte.
WeiterlesenBerühmt
Hilft nicht gegen Grippe – oder vielleicht doch? Michael Schweizer in „Kommune“, 6/11:
WeiterlesenJoe R. Lansdale: Gauklersommer
 Nichts Neues von Joe R. Lansdale. Gut halt. Aber wem sag ich das. Wer Lansdale mag, mag auch „Gauklersommer“, die Geschichte des Irak-Veteranen Cason Stadler, eines talentierten Journalisten, der einst am Pulizerpreis vorbeischrammte, in eine Art Daseinskrise gerät und sich in seine Geburtsstadt Camp Rapture im tiefsten Texas zurückzieht (den Lesern schon aus „Kahlschlag“ bekannt, damals 30er Jahre, nun Jetztzeit). Dort leben seine Eltern, der Bruder unterrichtet an der Uni, Stadler findet eine Anstellung als Kolumnist beim Ortsblättchen und alles ist irgendwie gut. Bis es verdammt schlecht wird.
Nichts Neues von Joe R. Lansdale. Gut halt. Aber wem sag ich das. Wer Lansdale mag, mag auch „Gauklersommer“, die Geschichte des Irak-Veteranen Cason Stadler, eines talentierten Journalisten, der einst am Pulizerpreis vorbeischrammte, in eine Art Daseinskrise gerät und sich in seine Geburtsstadt Camp Rapture im tiefsten Texas zurückzieht (den Lesern schon aus „Kahlschlag“ bekannt, damals 30er Jahre, nun Jetztzeit). Dort leben seine Eltern, der Bruder unterrichtet an der Uni, Stadler findet eine Anstellung als Kolumnist beim Ortsblättchen und alles ist irgendwie gut. Bis es verdammt schlecht wird.
Was ist Krimi? Neues aus der Zettelwirtschaft 11
Und ein neuer Packen Zettel. Diesmal mit einem weißen Wal, der zu einem roten Faden gehört, ein wenig Idiotenbashing (business as usual) und ein paar kühnen Behauptungen. Und nun weiter im Text.
Zettel 101: Es gibt keine schlechten Krimis. Es gibt schlecht geschriebene, schlecht recherchierte, schlecht erzählte, schlecht verkäufliche Krimis.
Manfred Wieninger: Das Dunkle und das Kalte
 Auch Kriminalromane, die nicht unter dem Etikett des Regionalen ächzen, spielen irgendwo. An realen oder fiktiven Orten, manchmal sowohl als auch, wie die Marek-Miert-Krimis von Manfred Wieninger. Harland heißt das triste Provinzkaff im Niederösterreichischen (man kann sich kaum vorstellen, dass auch dort die Sonne einmal scheint), eine Kopfgeburt wohl, doch unverkennbar nach dem Vorbild von Wieningers Geburtsstadt St. Pölten geformt. So springt das Faktische ins Fiktive und wieder zurück, ein Vorgang, in dem sich immer schon die Dynamik von Literatur entfaltet hat und immer entfalten wird. Jetzt hat Wieninger die Maske des Literaten für einen Moment abgenommen und führt uns durch sein Harland, wenn es St. Pölten heißt. Dass er dabei weiterhin Literat bleibt – wen wundert’s?
Auch Kriminalromane, die nicht unter dem Etikett des Regionalen ächzen, spielen irgendwo. An realen oder fiktiven Orten, manchmal sowohl als auch, wie die Marek-Miert-Krimis von Manfred Wieninger. Harland heißt das triste Provinzkaff im Niederösterreichischen (man kann sich kaum vorstellen, dass auch dort die Sonne einmal scheint), eine Kopfgeburt wohl, doch unverkennbar nach dem Vorbild von Wieningers Geburtsstadt St. Pölten geformt. So springt das Faktische ins Fiktive und wieder zurück, ein Vorgang, in dem sich immer schon die Dynamik von Literatur entfaltet hat und immer entfalten wird. Jetzt hat Wieninger die Maske des Literaten für einen Moment abgenommen und führt uns durch sein Harland, wenn es St. Pölten heißt. Dass er dabei weiterhin Literat bleibt – wen wundert’s?
Neu und anachronistisch
 Soweit die nackten Fakten. Ein anachronistischer Krimi, zu dem es auch schon einen Coverentwurf gibt (siehe unten), dem man vielleicht noch ein Detail hinzufügen könnte. Anachronistisch eben.
Soweit die nackten Fakten. Ein anachronistischer Krimi, zu dem es auch schon einen Coverentwurf gibt (siehe unten), dem man vielleicht noch ein Detail hinzufügen könnte. Anachronistisch eben.
Martin Compart: Die Lucifer Connection
 Der Weg zwischen Kunst und Trash ist lang. Jedenfalls wenn man sich das literarische Wertigkeitssystem als ein Gebäude vorstellt, der Krimitrash im von Schimmel und Schwamm heimgesuchten Souterrain und der fein-, tief-, hintersinnig komponierte „literarische Krimi“ ganz Penthouse-Resident mit den Annehmlichkeiten eines intellektuellen Dachgartens. Aber man kann sich das Ganze auch anders vorstellen. Als einen Kreis, der beim Krimi als reiner Kolportagekost beginnt und beim „Krimi als literarisches Kunstwerk“ endet. Dann kommt einem die Strecke zwischen den Extremen immer noch lang vor – doch eigentlich liegen sie ganz dicht beieinander.
Der Weg zwischen Kunst und Trash ist lang. Jedenfalls wenn man sich das literarische Wertigkeitssystem als ein Gebäude vorstellt, der Krimitrash im von Schimmel und Schwamm heimgesuchten Souterrain und der fein-, tief-, hintersinnig komponierte „literarische Krimi“ ganz Penthouse-Resident mit den Annehmlichkeiten eines intellektuellen Dachgartens. Aber man kann sich das Ganze auch anders vorstellen. Als einen Kreis, der beim Krimi als reiner Kolportagekost beginnt und beim „Krimi als literarisches Kunstwerk“ endet. Dann kommt einem die Strecke zwischen den Extremen immer noch lang vor – doch eigentlich liegen sie ganz dicht beieinander.
Rob Alef: Kleine Biester
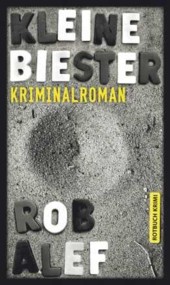 Darf ein Krimi, in dem reihenweise Kinder ermordet werden, lustig sein? Kann ein Krimi, der grässliche Monster durch die Berliner Unterwelt rumoren lässt, die Wirklichkeit widerspiegeln? Er darf, er kann. Hängt, wen wundert’s, vom Können des Autors ab und das ist im Falle von Rob Alef beneidenswert groß. „Kleine Biester“ heißt das Buch, was, hat man es zu Ende gelesen, durchaus doppelsinnig ist und dennoch einen sehr eindeutigen Blick auf die Verhältnisse erlaubt.
Darf ein Krimi, in dem reihenweise Kinder ermordet werden, lustig sein? Kann ein Krimi, der grässliche Monster durch die Berliner Unterwelt rumoren lässt, die Wirklichkeit widerspiegeln? Er darf, er kann. Hängt, wen wundert’s, vom Können des Autors ab und das ist im Falle von Rob Alef beneidenswert groß. „Kleine Biester“ heißt das Buch, was, hat man es zu Ende gelesen, durchaus doppelsinnig ist und dennoch einen sehr eindeutigen Blick auf die Verhältnisse erlaubt.
Prost
Ein Jahr →Drood-Projekt, 350 Folgen, über 600 (virtuelle) Druckseiten. Ein Grund, mich selbst zu feiern? Das auch. Aber vor allem den armen Schweinen Respekt zu zollen, die sich das seit einem Jahr, seit 350 Folgen antun. Leute, ihr habt mein Mitgefühl!
Was ist Krimi? Neues aus der Zettelwirtschaft 10
Heute mit Dickens und Higgins, einigen notorischen Arschgesichtern und Arschgedanken, der propperen Psycho-Anneliese und anderen organisierten Verbrechen. Und einem Jubiläumszettel, auf den ihr schreiben könnt, was ihr wollt. Vielleicht verratet ihr es mir? Die Kommentarfunktion ist immer noch aktiv, ich muss nur freischalten, wegen Spam, sorry.
WeiterlesenGeorge V. Higgins: Die Freunde von Eddie Coyle
 Eine gelesene Geschichte ist immer auch eine gesehene Geschichte. Unser Kopfkino verwandelt Wörter in Bilder, schnappt sich den Handlungsfaden und zieht ihn möglichst logisch-straff, um auf diesem Seil, dieser Sinn-Einheit, über den Abgrund zu tanzen, in den zu schauen man uns abgeraten hat. Vorsicht, Absturzgefahr, Vorsicht, disparate Teilchen unseres Daseins. Um dieses Kunststück bewerkstelligen zu können, hat man u.a. die erzählende Literatur erfunden. Aber Literatur wäre nicht Literatur, wenn sie den Erwartungen nicht gelegentlich davonliefe, indem sie sie erfüllt und gleichermaßen untergräbt. Einen solchen Text hat man bei „Die Freunde von Eddie Coyle“ vor sich.
Eine gelesene Geschichte ist immer auch eine gesehene Geschichte. Unser Kopfkino verwandelt Wörter in Bilder, schnappt sich den Handlungsfaden und zieht ihn möglichst logisch-straff, um auf diesem Seil, dieser Sinn-Einheit, über den Abgrund zu tanzen, in den zu schauen man uns abgeraten hat. Vorsicht, Absturzgefahr, Vorsicht, disparate Teilchen unseres Daseins. Um dieses Kunststück bewerkstelligen zu können, hat man u.a. die erzählende Literatur erfunden. Aber Literatur wäre nicht Literatur, wenn sie den Erwartungen nicht gelegentlich davonliefe, indem sie sie erfüllt und gleichermaßen untergräbt. Einen solchen Text hat man bei „Die Freunde von Eddie Coyle“ vor sich.
Beginnen wir mit dem filmischen Teil, was deshalb auch nahe liegt, weil dieser 1971 veröffentlichte (und erst 1989 ins Deutsche übersetzte) Roman von George V. Higgins gleich nach seinem Erscheinen mit Robert Mitchum verfilmt wurde. Wir folgen dem Titelhelden, einem Kleinkriminellen, durch die letzten Tage und Stationen seines Lebens. Doyle besorgt Schusswaffen, er ist Zwischenhändler, ein kleines Rädchen im kriminellen Getriebe wie andere auch, mit denen er sich trifft. Momentan gehen die Geschäfte gut, denn der Gangster Scalisi und seine Gang haben Bedarf an heißer Schussware für clever inszenierte Banküberfälle. Die ganze Geschichte ist eine Abfolge von Kalkül und Verrat, jeder ist sich selbst der nächste, jeder will überleben, und am Ende wird Eddie Coyle eben tot sein. Ein reinrassiges Gangsterdrama wäre das – wenn Higgins nicht etwas anderes im Sinn gehabt hätte.
Eine Mordsgeschichte wird recherchiert
Nichts als Zettel, Zettel, Zettel… Nein, jetzt gibt es auch ein merkwürdiges Stück aus „Was ist Krimi?“ zu lesen, einen Kurzkrimi gewissermaßen. Ein PDF mit Bildern, im Krimikultur:Archiv veröffentlicht, genauer: →hier. Viel Vergnügen oder auch nicht.
Was ist Krimi? Neues aus der Zettelwirtschaft 9
Von W.H. Auden bis zu geworfenen Tampons, über flüchtende Leserschaft und Hamster bei Facebook: Wieder einmal steckt in diesem Zettelkonvolut alles, was wir so am Krimi lieben. Live dabei sein könnt ihr bei Facebook.
Weiterlesen